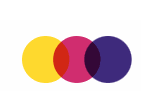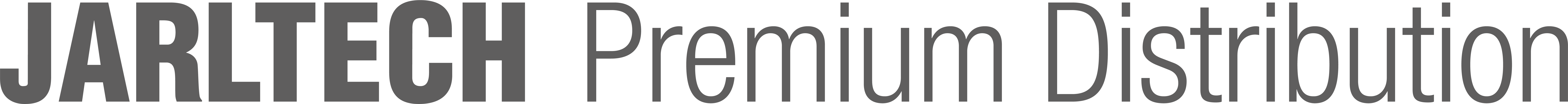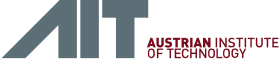Gleiche Gehälter sind selten gerecht
Trotzdem begegnet mir immer wieder dieser reflexartige Ruf: „Gleiche Gehälter für alle!“ Manche fordern es laut, andere wünschen es sich still. Aber was bedeutet das konkret? Gleichheit im Sinne von: „Gleiches Gehalt für gleiche Arbeit“? Klingt logisch, ist aber alles andere als trivial. Denn: Was ist „gleich“? Was ist „gerecht“?