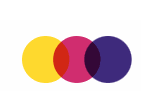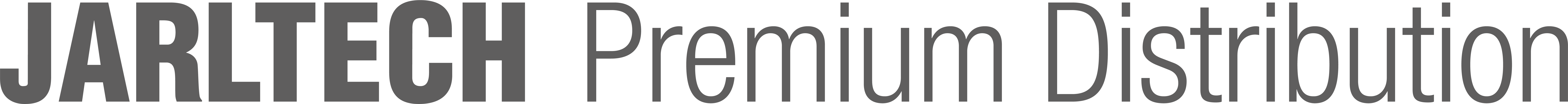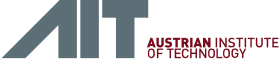Nicht das Problem ist das Problem
Wenn in Unternehmen über Probleme gesprochen wird, geschieht das meist mit einem fast rituellen Reflex: „Wir müssen etwas tun!“ Tun! Machen! Starten! Kaum fällt das Wort „Problem“, sitzen Berater im Besprechungsraum, Führungskräfte definieren Sollzustände und geben neue Ziele aus, Projekte werden initiiert und alle hoffen, dass Bewegung gleichbedeutend ist mit Lösung.
Doch vielleicht liegt genau darin das eigentliche Problem. Praktisch können wir zwei grundsätzliche Strategien unterscheiden:
1. Wir unterbrechen oder vermeiden ein Problem.
2. Wir verändern etwas oder starten Neues, um das Problem zu lösen.
Interessanterweise wird fast immer auf Variante zwei gesetzt. Es klingt ja auch aktiver, dynamischer, professioneller. Wer etwas „neues“ startet, zeigt Initiative. Das gibt dem Management ein gutes Gefühl und den Mitarbeitenden das Signal: „Es passiert etwas.“ Doch was passiert wirklich?
Oft wird schlicht der bestehende Alltag als gegeben akzeptiert. Man arbeitet an der Oberfläche, schraubt am Sollzustand, aber die Mechanik, die das Problem überhaupt erst erzeugt hat, bleibt unangetastet. Vielleicht braucht es nichts Neues.
Unternehmen könnten sich getrost einmal die provokante Hypothese stellen: „Vielleicht braucht es gar nichts Neues – sondern nur die Unterbrechung der Problemerzeugung.“
Das klingt seltsam, fast paradox. Nichts tun, um ein Problem zu lösen? Und doch ist es oft der direktere und günstigere Weg, um ein Problem gar nicht erst entstehen zu lassen. Denn viele Probleme sind keine Naturkatastrophen. Sie werden erzeugt – durch Strukturen, Regeln, Anreizsysteme, Meetings, Kommunikation und Nicht-Kommunikation.
Folgende Frage bringt uns weiter: Wie erzeugen wir eigentlich unsere Probleme? Die zentrale Frage lautet also nicht: Wie lösen wir das Problem? Sondern: Wie schaffen wir es eigentlich, dass dieses Problem überhaupt entsteht?
Ich höre oft Sätze wie:
„Unser Management führt nicht!“
„Wir sind zu wenig innovativ!“
„Wir arbeiten zu wenig zusammen!“
„Unsere Verkäufer interessieren sich nur für den Umsatz und nicht für das Team!“
Spannender ist doch die Gegenfrage:
„Wie schafft es das Unternehmen, dass Verkäufer sich nur auf den Umsatz konzentrieren?“
„Wie schafft es das Unternehmen, dass Mitarbeitende nicht zusammenarbeiten?“
Man könnte es noch zugespitzter formulieren:
Welche genauen Schritte müsste die Firma setzen, damit genau dieses unerwünschte Verhalten entsteht? Wer muss was tun oder besser: wer muss was unterlassen, damit das Problem bestehen bleibt? Welche Regeln, welche Rahmenbedingungen fördern das Verhalten, das wir beklagen?
Diese Fragen sind unbequem aber sie öffnen den Blick für den Mechanismus hinter dem Symptom.
Organisationen sind Problemerzeuger
In Organisationen existieren unzählige formelle und informelle Regeln, Normen, Vorschriften, Erwartungen. Sie lenken Verhalten und sie erzeugen Probleme. Nicht, weil jemand Böses will, sondern weil Strukturen wirken.
Deshalb ist der Fokus auf die Problemerzeugung viel wirkungsvoller als der auf die Problemlösung. Denn wer den Mechanismus versteht, kann ihn unterbrechen, kann ihn verändern. Wer ihn nicht versteht, wird ihn mit jedem gut gemeinten Change-Projekt nur reproduzieren.
Muster verstehen statt Symptome bekämpfen
Unternehmen sind durchzogen von wiederkehrenden Mustern. Diese Muster sind stabil, weil sie eine Funktion erfüllen. Also lohnt die Frage: Was ist eigentlich die Funktion dieses Musters? Vielleicht ist das, was wir „Problem“ nennen, in Wahrheit die logische Konsequenz eines erfolgreichen Musters. Dann geht es nicht darum, das Muster zu zerstören, sondern zu verstehen, welche Funktion es erfüllt – und welche Bedingungen es verändert, wenn es verschwindet.
Denn Muster sind nicht nur die Ursache von Problemen, sie sind auch die Voraussetzung für Erfolg. Und so endet die Suche nach dem Problem mit einer überraschenden Einsicht:
Nicht das Problem ist das Problem.
Das Problem ist, wie wir über sie denken.