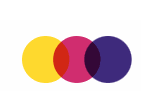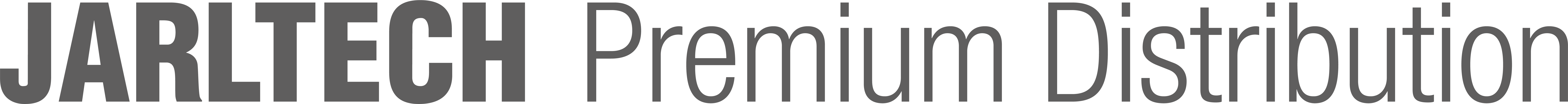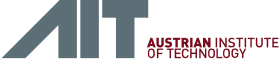Transparenz ist Haltung - nicht Maßnahme
Transparenz gilt als modernes Führungsgebot. Ein schillerndes Wort, das Führungskräfte gerne in ihre Präsentationen einsetzen und Mitarbeitende immer häufiger einfordern. Doch was genau meint es? Fragt man zehn Menschen, bekommt man zehn verschiedene Antworten. Das ist kein Zufall. Denn Transparenz ist kein objektiver Zustand. Transparenz ist ein Gefühl.
Es ist das Gefühl, alles zu wissen, was ich wissen muss, um meine Aufgaben sinnvoll zu erfüllen. Es ist das Vertrauen darauf, dass mir nichts Entscheidendes vorenthalten wird. Und genau deshalb kann Transparenz auch nicht verordnet werden. Sie entsteht nicht durch Maßnahmen oder Tools, sondern durch Kultur. Genauer gesagt: durch eine Kultur des Zutrauens.
Denn Vertrauen ist die Grundlage jeder empfundenen Transparenz. Ich muss darauf vertrauen können, dass ich als Mitdenker, Mitunternehmer, Mitarbeiter, Manager Zugang zu jenen Informationen habe, die ich brauche. Dass ich nicht manipuliert oder übergangen werde. Dass die Spielregeln klar sind – und für alle gelten.
Für Organisationen bedeutet das: Sie müssen Rahmenbedingungen schaffen, in denen dieses Vertrauen entstehen kann. Transparenz ist dabei sowohl Bringschuld der Führung als auch Holschuld der Mitarbeitenden. Es geht nicht um das blinde Offenlegen von Daten, sondern um gezielten Zugang zu relevanten Informationen. Dazu gehören offene Bücher, transparente Entscheidungsprozesse und der Verzicht auf Insiderwissen als Machtinstrument.
Wichtig: Transparenz ist nicht Kontrolle. Sie wird dann toxisch, wenn sie zum Vorwand für Überwachung wird. Der Harvard-Professor Ethan Bernstein zeigte in einer Studie, dass zu viel Sichtbarkeit kontraproduktiv sein kann. In einem chinesischen Fertigungsunternehmen, das stark auf Offenheit setzte, wurde buchstäblich ein transparentes Arbeitsumfeld geschaffen: offene Räume, viel Glas, keine Sichtbarrieren – alles sollte sichtbar, nachvollziehbar, überprüfbar sein. Der Gedanke dahinter: Je mehr Einblick alle haben, desto besser die Zusammenarbeit und Produktivität.
Doch Bernstein wollte wissen, was passiert, wenn man diesen offenen Ansatz punktuell zurücknimmt. In einem Experiment stattete er einzelne Teams mit einfachen Vorhängen aus, die sie von den Blicken anderer abgrenzten. Die Idee war, eine Art abgeschirmten Raum zu schaffen – nicht zur Isolation, sondern zur unbeobachteten Selbstorganisation.
Das Ergebnis war überraschend: Die Teams hinter den Vorhängen arbeiteten nicht nur effizienter, sondern auch kreativer. Sie testeten häufiger neue Arbeitsweisen, machten mehr eigene Vorschläge und fanden bessere Lösungen für Probleme. Ohne den ständigen Blick der Außenwelt, ohne das implizite Gefühl, beobachtet und bewertet zu werden, konnten sie freier agieren.
Bernstein prägte dafür den Begriff der „Zone of Privacy“ – ein geschützter Bereich, in dem Menschen sich ausprobieren dürfen, ohne sofortige Sichtbarkeit, ohne permanentes Reporting, ohne die Angst, bei jedem Zwischenschritt beurteilt zu werden. Es zeigt sich: Transparenz kann fördern, aber sie kann auch hemmen – dann nämlich, wenn sie zur ständigen Überwachung wird.
Transparenz verlangt also Maß. Sie lebt von Klarheit, nicht von Offenbarung. Von Vertrauen, nicht von Kontrolle. Wer Mitarbeitende permanent sichtbar macht, verhindert ihre Wirksamkeit. Wer Transparenz als Einladung zum Mitdenken versteht, stärkt ihre Verantwortung.
Ein gutes und oft zitiertes Praxisbeispiel für sinnvolle und wirksame Transparenz bietet das Unternehmen DM – Drogeriemarkt. Was bei DM auffällt, ist nicht nur dass Transparenz praktiziert wird, sondern wie: Nicht als Kontrollinstrument von oben, sondern als Einladung zur Mitgestaltung auf Augenhöhe.
In vielen Filialen ist es üblich, dass betriebswirtschaftliche Kennzahlen – etwa Umsätze, Ertragsspannen oder Zielerreichungen – offen im Team kommuniziert werden. Diese Informationen werden jedoch nicht einfach „verkündet“, sondern dienen als Ausgangspunkt für gemeinsame Reflexion: Was hat funktioniert? Was nicht? Was können wir als Team daraus lernen? Diese Gespräche finden regelmäßig statt – in Form von Teamrunden oder in sogenannten „Zielvereinbarungsgesprächen“, die weniger top-down, sondern dialogisch geführt werden.
Entscheidend ist dabei: Die Mitarbeitenden werden nicht mit Zahlen alleine gelassen. Sie erhalten Kontext, Bedeutung und die Möglichkeit, sich einzubringen. Ziel ist es, das unternehmerische Denken zu fördern – also das Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge, aber auch für die Rolle, die jeder Einzelne dabei spielt. Transparenz wird hier zur Befähigung, nicht zur Beurteilung.
Dieser Ansatz ist tief verwurzelt in der Unternehmensphilosophie von Gründer Götz W. Werner, der DM als „lernende Organisation“ verstand. Für ihn bedeutete Lernen nicht Schulung, sondern dialogisches Denken. Nicht Wissensweitergabe, sondern Sinnvermittlung. Die Idee: Menschen wollen und können Verantwortung übernehmen – wenn man ihnen das notwendige Wissen gibt und sie ernst nimmt.
Auch strukturell unterstützt DM diesen Gedanken: Es gibt keine individuellen Boni, keine rigide Zielvorgabe, sondern gemeinsame Verantwortung. Führungskräfte verstehen sich nicht als Vorgesetzte, sondern als Ermöglicher. Und Transparenz dient nicht der Kontrolle von Verhalten, sondern der Förderung von Urteilskraft.
Transparenz ist keine Frage der Technik, sondern der Haltung. Sie ist kein Fenster zur Überwachung, sondern eine Brücke zum Vertrauen. Entscheidend ist also nicht die Maximaltransparenz, sondern das richtige Maß – und der richtige Kontext.