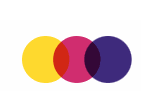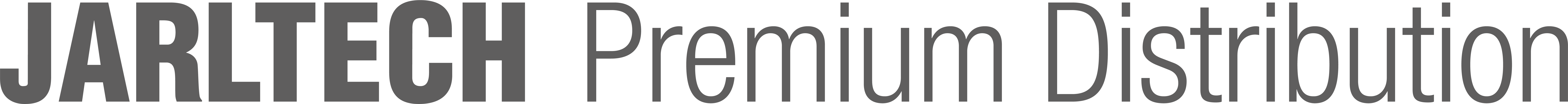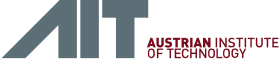Motivation ist angeboren, Demotivation ist gemacht
Gleich zu Beginn eine wichtige Klarstellung: Führungskräfte können Menschen nicht motivieren – sie können aber sehr wohl demotivieren. Die eigentliche Motivation entsteht in jedem Menschen selbst, sie ist intrinsisch. Aufgabe von Führung ist es daher nicht, Motivation zu erzeugen, sondern Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Motivation erhalten bleibt und sich entfalten kann. Menschen bringen von Natur aus Motivation mit – sie wollen gestalten, lernen und beitragen. Jede Form der äußeren „Motivierung“ läuft Gefahr, diese innere Kraft zu überdecken oder gar zu verdrängen.
Führung – so wie sie heute noch vielerorts praktiziert wird – verdrängt Motivation. Sie zersetzt sie schleichend. Durch Kontrolle. Durch Zielvorgaben. Durch individuell zugeschnittene Bonusmodelle. Letztere sind ein hervorragendes Beispiel: Natürlich wollen Mitarbeiter ihre Boni erreichen – wer will schon freiwillig auf Geld verzichten? Doch wehe, die Prämien bleiben aus. Dann schlägt Motivation in Frust um. Dann wird der Kollege nicht mehr als Teampartner gesehen, sondern als Bonus-Konkurrent. Was einst motiviert hat, wird zur Demotivationsfalle.
Motivation ist nicht das Problem. Die Bedingungen sind es. Wenn also Motivation die Lösung ist, was ist dann das Problem?
Das Problem sind die Rahmenbedingungen, die tagtäglich demotivieren: überfrachtete Reportings, CRM-Eingaben, überflüssige Meetings, fehlendes oder nicht existentes Onboarding, individuelle Belohnungen für vermeintliche Leistungsträger – kurz: ein System, das Menschen klein hält, statt sie groß zu denken.
Führungskräfte täten gut daran, sich nicht als Animateure der Motivation zu sehen, sondern als Gestalter der Bedingungen. Denn nur wenn das System stimmt, kann Motivation gedeihen.
Drei Säulen echter Motivation: Kompetenz, Autonomie, soziale Eingebundenheit
Diese Erkenntnis ist nicht neu. Edward Deci und Richard Ryan haben sie in ihrer Selbstbestimmungstheorie wissenschaftlich fundiert. Daniel Pink hat sie populär gemacht. Und trotzdem agieren viele Organisationen, als hätten sie nie davon gehört. Hier also die Essenz:
Kompetenz
Menschen wollen wirken. Sie wollen spüren, dass sie etwas können – und dass dieses Können zählt. Wer sich entwickeln darf, bleibt engagiert. Der Qualifikationsraster ist dabei kein Kontrollinstrument, sondern ein Spielfeld freiwilliger Weiterentwicklung. Die Idee, jemand sei „überqualifiziert“, ist eine Bankrotterklärung an die Intelligenz der Organisation. Es gilt: Je mehr einer kann, desto wichtiger wird er für das Ganze.
Autonomie
Menschen wollen selbst bestimmen. Nicht alles – aber viel. Wer mit wem, wann, wo und wie gearbeitet wird, das darf nicht mehr zentral entschieden werden. Autonome Teams schaffen Raum für eigenverantwortliches Handeln. Wer dagegen Arbeitszeiten kontrolliert oder Berichte zur Pflicht macht, infantilisiert Erwachsene und provoziert innere Kündigung. Vertrauen ist keine Kuschelmaßnahme. Es ist eine Investition in Selbstverantwortung – und in Disziplin.
Soziale Eingebundenheit
Menschen sind keine Einzelkämpfer. Sie brauchen Zugehörigkeit. Nein, Teams sind keine Familien – sie sind Leistungsgemeinschaften. Aber sie geben Halt. Sie geben Identität. Wer arbeitet, will nicht nur wirken, sondern dazugehören. Jeder Mitarbeiter verdient ein berufliches Zuhause – einen Ort, an dem er nicht nur arbeitet, sondern auch gesehen und wertgeschätzt wird.
Was ist mit Geld? Natürlich spielt es eine Rolle. Aber Geld belohnt, es motiviert nicht nachhaltig. Schlimmer noch: Es verdrängt die intrinsische Motivation. Die Karotte, die wir Mitarbeitern hinhängen, lenkt den Blick weg vom Sinn der Arbeit hin zur Belohnung. Das Ergebnis: Menschen arbeiten für das Geld, nicht für die Sache.
Die Alternative: Team-Beteiligung. Erfolg wird nicht individuell abgeerntet, sondern gemeinsam gefeiert. Alle bekommen ihren Anteil – gleich hoch, unabhängig vom Grundgehalt. Der Effekt: Zusammenarbeit statt Konkurrenz. Gemeinsame Erfolge statt isolierter Boni.
Hört auf zu motivieren! Menschen brauchen keine Karotten. Sie brauchen ein Umfeld, das sie als denkende, fühlende und eigenverantwortliche Wesen behandelt. Hört auf mit Motivationsmaßnahmen – und fangt an, Menschen zu vertrauen. Gestaltet Bedingungen, unter denen Motivation wachsen darf. Und behandelt Mitarbeiter so, wie wir sie uns wünschen: als Mitunternehmer.