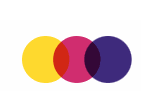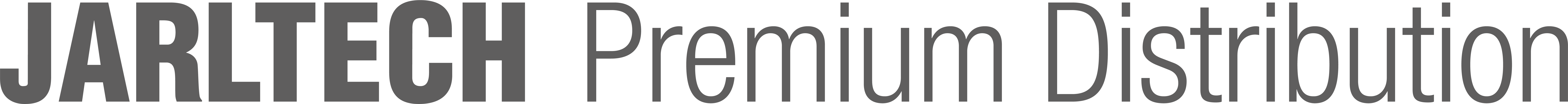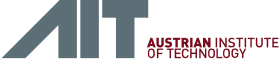Gleiche Gehälter sind selten gerecht
Trotzdem begegnet mir immer wieder dieser reflexartige Ruf: „Gleiche Gehälter für alle!“ Manche fordern es laut, andere wünschen es sich still. Aber was bedeutet das konkret? Gleichheit im Sinne von: „Gleiches Gehalt für gleiche Arbeit“? Klingt logisch, ist aber alles andere als trivial. Denn: Was ist „gleich“? Was ist „gerecht“?
Diese Begriffe werden gerne synonym gebraucht, stehen aber in einem ständigen Spannungsverhältnis. Gleichheit ist ein mathematischer Begriff. Gerechtigkeit ein emotionaler, mehr ein Gefühl. Und während Gleichheit ein Maßband anlegt, das alle auf dieselbe Höhe zwingt, fragt Gerechtigkeit: Was ist für diesen einen konkreten Fall angemessen?
Gerechtigkeit braucht Kontext
„Gleiches gleich, Ungleiches ungleich behandeln.“ Das klingt einfach, ist es aber nicht. Denn: Gleiche Fälle gibt es in der Praxis kaum. Jeder Mensch bringt etwas Eigenes mit: eine andere Erfahrung, andere Kompetenzen, andere Verantwortung. Wer hier mit dem Gleichheitslineal hantiert, verkennt die Individualität und verfehlt die Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit braucht Kontext und entsteht aus transparenten, nachvollziehbaren Parametern. Ich habe in einem anderen Kapitel den „Quali-Raster“ vorgestellt, ein System, das Kriterien wie Fachkenntnis, Verantwortung, Beitrag zum Unternehmenserfolg und persönliche Entwicklung bewertet. Es macht Gehaltsentscheidungen greifbar. Nicht beliebig, nicht emotional, sondern erklärbar.
Aber Gerechtigkeit endet nicht im Unternehmen. Es gibt auch den Markt. Dort wird der Wert einer Kompetenz bemessen. Dort entscheidet sich, wie gefragt eine Fähigkeit gerade ist und wie knapp sie verfügbar ist. Wer diese externen Faktoren ausblendet, vergisst eine schlichte Wirklichkeit: Ein Gehalt spiegelt den Preis für Knappheit wider.
So sieht es in der Praxis aus: Das Gehalt einstellen
Ich habe Unternehmen erlebt, die dieses Spannungsverhältnis produktiv nutzen: Sie evaluieren jährlich zwei Achsen: die Qualifikation des Mitarbeiters und die aktuelle Marktlage. Dann sprechen sie einmal über das Gehalt und danach nie wieder in diesem Jahr, bis zum nächsten Jahr. Das Gehalt wird sinngemäß einmal im Jahr eingestellt. Nicht zwischendurch, nicht willkürlich, sondern fokussiert, nachvollziehbar, begründet. Der Rest des Jahres gehört dem Kunden. Und dem Geschäft.
Das Ergebnis ist erstaunlich klar: Wer sich entwickelt, wer Neues lernt, wer mehr beiträgt wird mehr verdienen. Nicht, weil er es fordert, sondern weil er es wert ist. Der Zusammenhang ist logisch: Je relevanter der Beitrag eines Menschen, desto größer sein Wert für das Team und für das Unternehmen. Und das nicht im Sinne von „Ich will mehr“, sondern aus der Haltung: „Ich übernehme mehr.“
Doch ich habe auch das Gegenteil erlebt: Menschen, deren Gehalt nicht mehr zur aktuellen Leistung passt. In diesen Fällen braucht es kein Drama, nur Klarheit und Konsequenz. Manchmal ist es ein Entwicklungsgespräch. Immer aber ist es ein gemeinsamer Blick auf die Wirklichkeit. Gerechtigkeit ist kein Geschenk, sie ist Arbeit. Wer Gleichheit fordert, muss bereit sein, sich der Komplexität zu stellen und zu akzeptieren: Gleiches ist selten gleich und gerechtes Handeln bedeutet, Unterschiede zu machen und diese zu begründen.